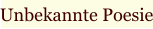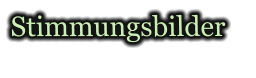
Josef Peneder
Nachts im Bootshaus
Sanft, wie selbstverständlich,
schlägt das schwarze Wasser von unten an die Stege,
dazwischen atmen die hölzernen Ruderboote,
dunkle, längliche Laibe,
den warmen Duft des heißen Sommertags geduldig aus,
wie Kühe im Stall, müde, zufrieden;
gelegentlich klirrt eine Kette, die ohne Zwang den schweren Körper hält.
Die Ruder an den Wänden ruhen paarweise, schlank und elegant.
Ich nehme zwei vom Haken, löse ein Boot mit sanftem Stoß,
geräuschlos gleiten wir hinaus in die mondhelle Stille
vorbei am Schilf und den Seerosen
auf einem Spiegel aus lebendigem Silber
unter den unendlichen Sternen,
die Seine Größe verkünden.
Josef Peneder
Kalter Wein
Fragment, zufällig wieder entdeckt; datiert ca. 1989
Pamhagen
ist
ein
kleiner
Ort
im
hintersten
Winkel
des
Burgenlandes.
Hierher
verirrt
sich
zu
dieser
Jahreszeit,
es
ist
Anfang
November,
kein
Tourist
mehr.
Daher
betrachten
auch
die
Einheimischen
die
beiden
Fremden,
die
da
vor
dem
Gasthaus
„Zum
Türkenturm“
geschmeidig
aus
einer
dunkelblauen
Limousine gleiten, mit unverhohlener Neugier.
Der
Wirt
des
Türkenturms
erkennt
sie
wieder:
„Grüß
Gott,
Herr
Paule,
Grüß
Gott,
Herr
Peneder!
Schön,
Sie
beide
wieder
hier
zu
haben!“
Wir grüßen artig und fragen nach einem Zimmer für diese Nacht.
„Ein
Zimmer?“
Der
Türkenwirt
lacht.
„Da
haben
Sie
Pech,
Sie
zwei!
Aber
warten
Sie,
meine
Herren!“
Er
deutet
nach
vorn.
„Dort,
in
dem
Haus
mit
dem
hohen
Giebel,
da
fragen
Sie!
Aber
sagen
Sie
dazu,
dass
ich
Sie
schicke,
meine
Herren;
da
wohnen
nämlich
misstrauische
Leute,
die
schlafen
mit
der
Pistole
unter
dem
Kopfkissen,
und
außerdem
haben
sie
scharfe
Hunde.
Also
–
machen Sie’s gut, Sie beide!“
Das
Haus
ist
stockfinster.
Kälte
kriecht
in
die
Kleidung,
die
klammen
Finger
tasten
nach
der
Türklinke.
Mit
einem
langgezogenen
Klagelaut
gibt
die
Tür
nach.
Wir
stehen
in
einem
dunklen
Gang,
der
in
einen
kahlen
Hinterhof
mündet.
Es
riecht
nach
Raubtieren
und
Aas.
Wir
tasten
uns
an
der
Wand
entlang.
Totenstille
herrscht
und
Finsternis.
Der
Atem
lässt
weiße
Nebel
vor den Gesichtern aufsteigen.
Jeder
Schritt,
das
Knirschen
des
Sandes
unter
den
Schuhen,
wird
lauter
und
lauter,
zurückgeworfen
von
den
Wänden,
harte,
klare
Geräusche, die die Stille mit Messerschnitten durchbrechen.
Wir
stehen
still.
Ein
zarter
Nachhall
dröhnt
noch
durch
das
Gewölbe,
minutenlang
scheinbar,
doch
in
Wahrheit
nur
einige
Herzschläge.
Dann
ist
irgendwo
ein
Lichtschimmer,
eine
Tür
wird
geöffnet
auf
der
anderen
Seite
des
Hofes.
Dort
steht
ein
alter
Mann,
versucht
uns wahrzunehmen, etwas zu erspähen in der Finsternis.
Paule
gibt
sich
einen
Ruck
und
geht
auf
ihn
zu.
Der
Alte
zuckt
zusammen.
Minuten
später
stehen
wir
wieder
auf
der
Straße.
Die
Zimmer
sind
eiskalt,
werden
jetzt
nicht
mehr
geheizt;
vielleicht
hat
die
Frau Fleischhacker warme Betten für die Herren.
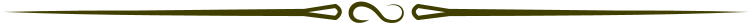
Josef Peneder
Herbst
Das milde Licht des Sommers wich
dem klaren, harten Glanz.
Die Wälder rings verändern sich
und sterben doch nicht ganz.
Ein kalter Windhauch weht herein,
er kündet Nacht und Tod,
derweil im reinen Sonnenschein
die Blätter leuchten rot.
Noch wärmt des Herbstes Sonne Kraft
die windgeschützte Laube,
doch bald schon werden hingerafft
die Blätter, und werden zu Staube.
So finden sich im Herbst vereint
das Leben und der Tod,
die Üppigkeit der Erntezeit,
des Winters kalte Not.
Josef Peneder
Der unbotmäßige Knabe
Es
war
einmal
ein
kleiner
Junge,
der
befleißigte
sich
ab
und
an
eines
unbotmäßigen
Verhaltens.
So
bedachte
er
seine
Lehrkräfte
nur
höchst
unzureichend
mit
gebührlichem
Respekt,
sprach,
wann
immer
ihm
der
Sinn
danach
stand
und
versetzte
seine
Umgebung
nicht
selten
in
höchliches
Entsetzen,
indem
er
die
Stätte,
so
ihm
zur
Verrichtung
seiner
Arbeiten
zugewiesen,
schweigend
verließ.
Oftmals
wandelte
er
dann
aus
Erziehungsheim
oder
Schule,
verbarg
sich
im
Geäst
hinter
der
Kirchmauer
und
lachte still vor sich hin, wenn man ihn suchte.
Nun
wirkte
in
derselben
Anstalt
ein
Pädagoge,
dessen
vorrangiges
Lebensziel
er
in
seiner
eigenen
Zufriedenheit
und
Ruhe
erblickte.
Den
Lehrberuf
hatte
er
vornehmlich
aus
Bequemlichkeit,
aus
Gewohnheit
ergriffen,
denn
es
war
ihm
nach
erlangter
Matura
der
Gedanke
unerträglich,
die
Schule,
deren
bedächtige
Betriebsamkeit
er
zu
schätzen gelernt hatte, verlassen zu müssen.
So
wenig
er
nun
diese
Berufswahl
zu
bereuen
hatte,
so
gab
es
doch
immer
wieder
Ungemach
durch
einzelne
Störenfriede,
die
seinen
Wunsch
nach
Ruhe
und
Gleichmaß partout nicht zu respektieren vermochten.
Eines
schicksalhaften
Tages
begab
es
sich
nun,
dass
jener
Pädagoge,
wir
nennen
ihn
P.,
in
die
Direktion
gerufen
ward
zwecks
Vorsprache
und
ihm
daselbst
vom
wohlwollenden,
aber
findigen
Direktor
der
Wunsch
unterbreitet
wurde,
er
möge
sich
fortan
tunlichst
um
das
Wohl
und
Fortkommen
des
unbotmäßigen
Knaben
annehmen,
ihn
in
fachlicher
und
erzieherischer
Hinsicht
fördern
und
jedenfalls
sei
ihm
ab
dato
die
unumschränkte
Verantwortung für die Angelegenheit übertragen.
P.
wusste
seine
Energien
haushälterisch
zu
verwalten,
daher
nickte
er
nur
stumm
und
begab
sich
in
seine
Studierstube,
um
daselbst
zu
sinnieren,
wie
mit
der
ungeliebten Situation umzugehen sei.
Nach
wenigen
Stunden
intensiven
Wälzens
von
Gedanken
manifestierte
sich
schließlich
das
Zauberwort
vor
dem
geistigen
Auge
des
in
diese
prekäre
Lage
Gestoßenen:
Anpassung!
Dass
er
den
Knaben
verändern,
gar
erziehen
könnte,
hielt
er
bei
der
geringen
Belastbarkeit,
mit
welcher
er
von
der
Natur ausgestattet war, für ausgeschlossen.
Nein,
er
musste
vielmehr
die
verstörende
Art
des
Knaben
in
sich
selbst
aufnehmen,
werden
wie
dieser,
spontanen
Eingebungen
zugeneigt,
Konventionen
nicht
achtend,
das
Absurde,
Skurrile
zur
Grundlage
seiner
Lebensäußerungen erwählen, nein besser: erkiesen!
Schon
merkte
er,
wie
ihn
sein
neues
Lebensgefühl
mitriss:
...erkiesen, erkiesen...
"Ich
werde
die
Welt
erkiesen!",
sagte
er
laut
und
verließ
seine
Studierstube,
um
sich
im
Geäst
hinter
der
Kirchmauer zu
verbergen.

Texte aus fünf Jahrzehnten
© Josef Peneder 2016 Version 3.0 / 27.11.2023
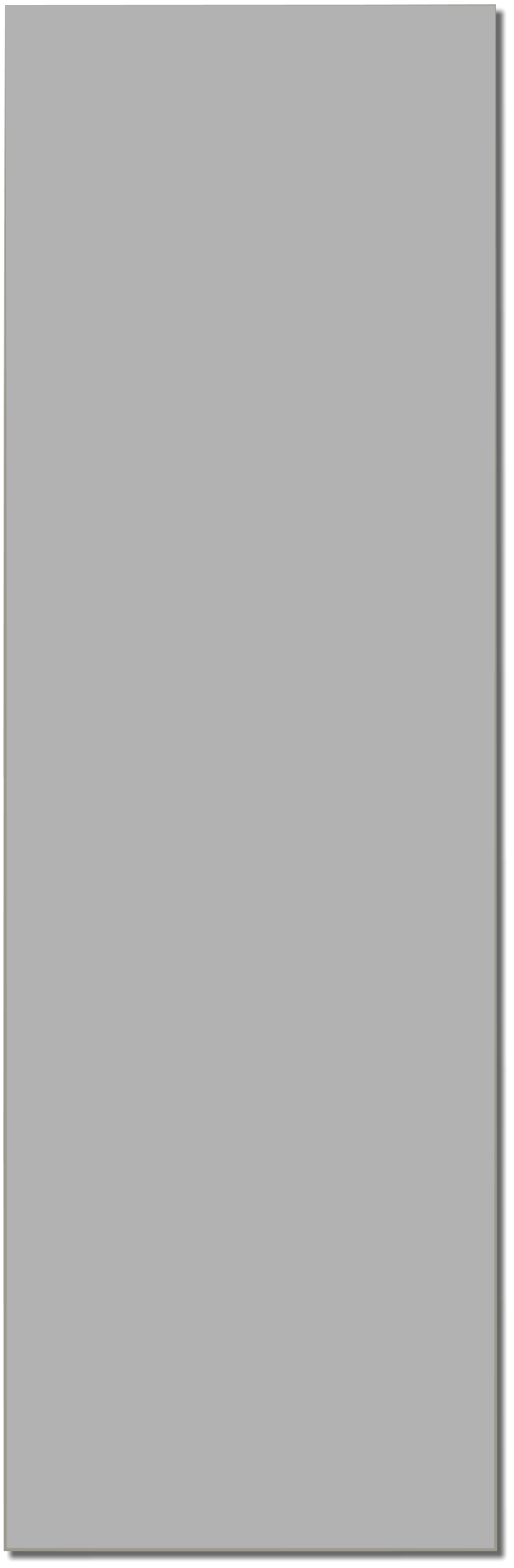
Ich war auf einer Beerdigung
Ich war auf einer Beerdigung.
Eine Mutter, einundneunzig.
Friedlich entschlafen, eine brave, anständige, tapfere Frau.
Ich war auf der Beerdigung.
Ich sah die Tränen der Kinder.
Ich sah die Tränen der Enkelkinder.
Ich sah, wie der Sarg in die Erde hinabgesenkt wurde.
Ich sah den Schmerz in den Gesichtern.
Ich sah die Tränen der Kinder, der Enkelkinder.
Ich hörte die Worte des Predigers.
Ich hörte den Klang der Oboe.
Ich sah den Schmerz in den Gesichtern der Kinder und Enkelkinder.
Ich sah das Mitleid, die Trauer der Umstehenden.
Die Worte des Predigers waren voll Hoffnung.
Die Oboe klang schwermütig, aber auch sehnsuchtsvoll.
Der Himmel war grau, es hatte vorher heftig geregnet.
Die Trauernden standen dunkel zwischen den Gräbern.
Der Bestatter sprach salbungsvolle Dankesworte.
Die Hinterbliebenen warfen Blumen auf den Sarg.
Die Enkelkinder weinten.
Ihre Eltern hielten sie fest an sich gedrückt.
Der Himmel war grau, wolkenverhangen.
Meine Gedanken schweiften ab.
Wieviel Mitgefühl, wieviel Dankbarkeit.
Ein Mensch, der seinen Lebensweg vollendet hat.
Trauer um eine Mutter, ein reich gesegnetes Leben.
Eine stille, bescheidene Frau, die noch Urenkel erleben durfte.
Die selbst voller Liebe, Dankbarkeit, Glaube und Gewissheit war.
Die dunklen Wolken bewegten sich langsam.
Ich konnte die frisch aufgeworfene Erde riechen.
Feuchte Frühlingsluft.
Neubeginn, Hoffnung.
Meine Gedanken schweiften ab.
Ich sah die Ertrunkenen am Strand.
Ich sah die namenlosen Toten im Meer treiben.
Ich sah ertrunkene Kinder, verzweifelte Mütter.
Ich sah die Gesichter der Menschen, die vor dem Krieg wegliefen.
Ich sah die Verzweiflung in den Gesichtern.
Ich sah die Verzweiflung der Menschen, die dem Hunger entkommen wollten.
Ich hörte die Wellen an den Strand rauschen.
Sie bewegten die Leichen.
Ich sah Menschen im Wasser treiben.
Ich sah Boote, die voll waren mit Hoffnung und Angst.
Ich sah Menschen am Straßenrand.
Ich sah Frauen, Kinder, junge Männer an Zäunen stehen.
Zelte im Schlamm.
Menschenmengen vor irgend einer Polizeistation.
Soldaten und Polizisten.
Ich hörte Politiker reden.
Sie sahen aus wie Menschen.
Sie hatten Anzug und Krawatte, gepflegtes Auftreten.
Sie waren ordentlich frisiert.
Ich hörte sie reden.
Mir graute vor dem, was sie sagten.
Sie sprachen, als wüssten sie Bescheid.
Sie sprachen, als kennten sie die Umstände.
Ihre Rede klang wohlüberlegt.
Sie sprachen von der Notwendigkeit.
Sie sprachen von Bedingungen.
Sie sprachen zu jenen, die genauso denken.
Zu den Überheblichen.
Zu den Hochmütigen.
Zu den Gottlosen.
Zu den Selbstgerechten.
Zu den Spöttern, denen ein Menschenleben nicht heilig ist.
Sie redeten, als gäbe es wertvolle und wertlose Menschen.
Sie redeten, als stünde ihnen darüber ein Urteil zu.
Sie redeten, als seien jene selbst Schuld an ihrer Not.
Sie redeten, als könnte ihnen das alles nie passieren.
Sie schauen in ihrer Selbstgerechtigkeit auf jene herab, die anders denken.
Sie verachten jene, die Mitleid empfinden.
Sie spotten über die, die helfen.
Sie schimpfen über die, die Grenzen öffnen wollen.
Ihr Gewissen haben sie geopfert.
Ihre Härte kommt aus dem Zwang der Gleichgesinnten.
Ihre Kälte entspringt ihrem Egoismus.
Ihre Kraft kommt aus der Angst, Schwäche zu zeigen.
Ihr leeres Gewissen füllen sie mit Traditionen.
Ihre Unmenschlichkeit nennen sie Recht und Ordnung.
Ihre Lieblosigkeit nennen sie Werte.
In Wahrheit haben sie Angst vor wacher Geisteskraft.
In Wahrheit scheuen sie spontane Entscheidungen.
In Wahrheit müssen sie sich am Stammtisch Mut machen.
Im Kreise Gleichgesinnter müssen sie sich in ihren Meinungen bestärken.
In Wahrheit haben sie Angst.
Sie fürchten, was sie nicht kennen.
Sie fürchten das Fremde, weil sie es nicht verstehen.
Sie fürchten die Menschlichkeit, weil sie unberechenbar ist.
Sie fürchten den Intellekt, weil er für sie unerreichbar bleibt.
Sie klopfen sich lieber gegenseitig auf die Schulter.
Sie denken an ihre Wähler.
Sie denken an ihre Karriere.
Sie denken an ihre Zukunft.
Sie haben keine Zukunft.
Sie haben die Zukunft begraben.
Ich war auf der Beerdigung!


Wenn die Guten nicht kämpfen, werden die Schlechten siegen.
Platon